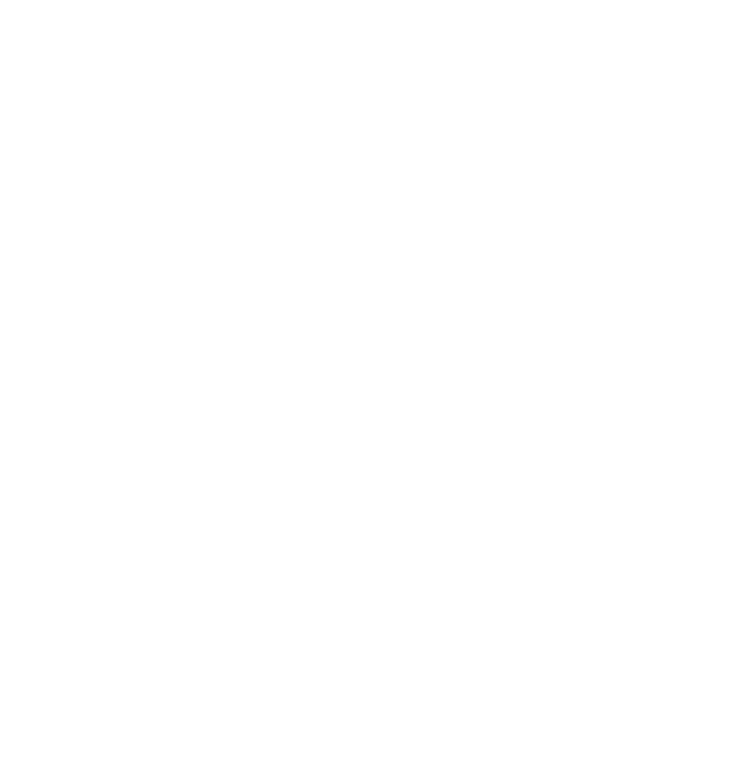Wer sind wir | Geschichte
Geschichte von Holstein Switzerland
Unsere Genossenschaft ist der Hüter des Schweizer Holstein-Herdebuchs.
Mit der Führung des Herdebuchs, der Leistungskontrolle und der Zuchtwertschätzung unternimmt er alles, um sichere und zuverlässige Selektionsinstrumente gemäss Tierzuchtverordnung (TZV 916.310) zur Verfügung zu stellen. Als Dienstleistungsbetrieb bietet die Genossenschaft seinen Mitgliedern zahlreiche andere geeignete und nützliche Dienstleistungen für das Herdenmanagement zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis an. Ein von Vertrauen und Nähe geprägter Kontakt zu den Mitgliedern ist eine Priorität für die Mitarbeitenden der Genossenschaft.
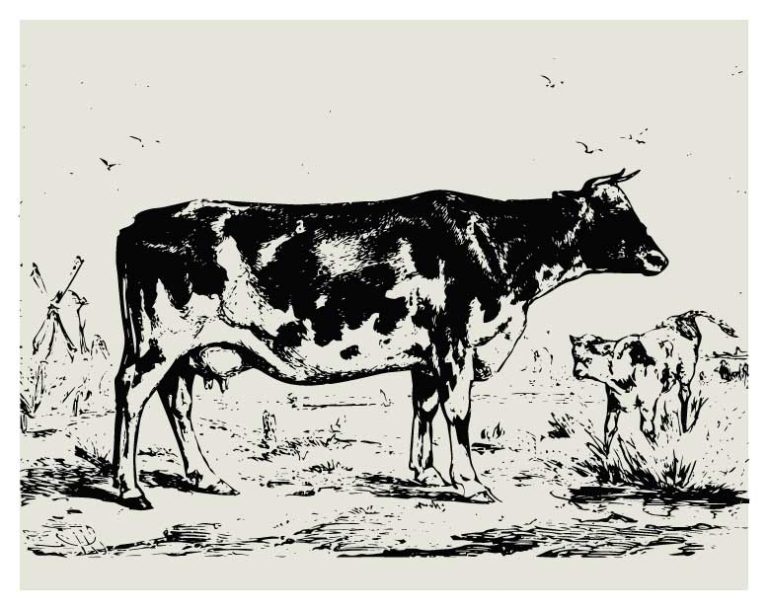
1890
Die erste Schwarzfleckviehzuchtgenossenschaft
Die erste Schwarzfleckviehzuchtgenossenschaft wurde 1890 in Treyvaux (FR) gegründet. Zum diesem Zeitpunkt begann das Konzept der Rasse eine wichtige Rolle zu spielen, und die Idee kam auf, sich zusammenzuschliessen, um einen qualitativ hochstehenden Stier zu kaufen oder eine Alp für die Sömmerung zu mieten oder zu kaufen.
1891
Andere Genossenschaften
Zwischen 1891 und 1899 wurden rasch andere Genossenschaften gegründet. Das Schwarzfleckvieh war zu diesem Zeitpunkt ausserhalb des Kantons Freiburg kaum verbreitet. Im Neuenburger Jura und viel später im Kanton Basel wurden ebenfalls Zuchtgenossenschaften für diese Rasse von Züchtern gegründet.
1899
Der schweizerische Verband
Der schweizerische Verband wurde 1899 gegründet. Am Anfang bestanden seine Hauptaufgaben darin, den jährlichen Stiermarkt in Bulle zu organisieren und den Viehexport zu koordinieren. Erst später übernahm er die Führung des Herdebuchs vom Bund.
1940
Nachdenkliche Situation
Anfang der 1940er-Jahre war die Situation des Schwarzfleckviehs beunruhigend.
1944
Abgrenzung der Rassengebiete
Gemäss Bundesbeschluss von 1944 über die Abgrenzung der Rassengebiete musste eine Rasse mindestens 20% des gesamten Bestandes oder mindestens 1'000 Tiere zählen, um in einer Region anerkannt zu werden. Angesichts dieser sehr strengen Bedingungen fand man Schwarzfleckviehherden nur noch in einigen Regionen der Kantone Freiburg, Neuenburg und Basel. Das Überleben der Rasse war gefährdet, da keine neuen Genossenschaften gegründet werden konnten. Der Schwarzfleckviehbestand nahm weiter ab. Der Schwarzfleckviehbestand nahm weiterhin ab.
1950
Herdbuchregistrierung
In den 1950er-Jahr waren nur noch 8‘000 Kühe im Herdebuch registriert. Als Folge der Bestandsabnahme nahm der Blutverwandtschaftsgrad stark zu. So kam der Erbfehler der sogenannten Schlittenkälber, der auf den Stier Mouton aus Sâles (FR) zurückging, immer häufiger vor, und die Lage der Rasse war mehr als prekär. Anfang der 1950er-Jahre wurden erste Kreuzungsversuche mit zwei aus Deutschland importierten Friesischen Stieren gemacht.
1960
Friesische Rasse
Die ersten Samendosen von Friesischen Stieren wurden dann zu Beginn der 1960er-Jahre importiert. Es wurden auch Friesische Kälber und Kühe aus Deutschland und Frankreich über die Grenze geschmuggelt. 1966 hob der Bundesrat die Rassenzonen auf. Die Situation verbesserte sich für das Schwarzfleckvieh. Gleichzeitig wurde die Besamung liberalisiert, und der Samenimport wurde unter gewissen Bedingungen zugelassen.
1966
Unterdrückung von Rassengebieten
1966 importierte der Schweizerische Schwarzfleckviehzuchtverband zum ersten Mal 1‘000 Holstein-Samendosen aus Kanada. Eine Züchterreise nach Kanada und die Qualität der Kreuzungen mit der Holstein in der Schweiz bestätigten den gewählten Weg. Nach einem vorsichtigen Start nahmen die Samenimporte explosionsartig zu.
1973
29.000 besamte Weibchen
1973 wurden 29’000 weibliche Tiere mit Holstein-Sperma besamt. Der Bund hemmte jedoch erneut die Entwicklung in Richtung einer produktiven Kuh durch eine Einschränkung des Samenimportes.
1981
33% der Besamungen
Der Anteil der Besamungen mit importiertem Samen auf den Herdebuchbetrieben wurde 1981 auf 33% festgelegt. Nicht angeschlossene Betriebe hatten bereits seit 1975 kein Anrecht mehr darauf. Die sanitären Anforderungen schränkten später den Zugang zu interessanten Stieren nochmals ein. Dank ihrer Leistung, Euterqualität, guten Melkbarkeit und Grösse, die den Landwirten eine wirtschaftliche Milchproduktion erlaubte, ersetzte die Holsteinrasse unaufhaltsam das Freiburger Zweinutzungs-Schwarzfleckvieh. So konnte sich die Holsteinkuh in den 1970er- und 1980er-Jahren in der ganzen Schweiz etablieren, und es wurden zahlreiche Holstein-Zuchtgenossenschaften in der Deutschschweiz gegründet. Der Bestand erhöhte sich rasch von 2 auf 10% des gesamten Milchviehbestandes.
1995
Einführung der integralen LBE
Der Schweizerische Holsteinzuchtverband SHZV entschied als erster, die kantonale Punktierung aufzuheben und die integrale lineare Beschreibung und Einstufung mit der Schaffung eines eigenen LBE-Dienstes einzuführen.
1997
Lancierung von Gestho
Um alle Daten seiner Mitglieder und der registrierten Tiere modern und effizient zu bearbeiten, führte der SHZV ein internes Verwaltungssystem ein (Gestho). Den Züchterinnen und Züchter standen nun neue Dokumente zu Verfügung, die lesbarer und besser strukturiert waren.
1999
100. Jubiläum und Europäischer Holstein-Kongress
Der SHZV feierte 1999 sein 100. Jubiläum. Nebst einer Viehschau (EXPO Bulle) und einer Festversammlung im neuen Zentrum Espace Gruyère in Bulle organisierte der Verband den Europäischen Holstein-Kongress in Charmey (FR).
2002
Lancierung von HolsteinVision
Im Bestreben, modern und innovativ zu bleiben, lancierte der SHZV HolsteinVision, das digitale Herdenmanagementsystem für die Züchterinnen und Züchter. Die Mitglieder haben seither einen direkten Zugriff auf alle ihre Daten über diese Webseite. Die interaktive Seite ermöglicht den Züchterinnen und Züchtern auch, viele Daten direkt im System zu erfassen.
2010
Genomische Zuchtwertschätzung
Der SHZV revolutionierte die Zucht mit der Einführung der genomischen Zuchtwertschätzung. Dank der DNA-Analysen konnten die Merkmale der Tiere von nun an ab dem Zeitpunkt ihrer Geburt präzise bestimmt werden.
2010
Die ersten Meisterzüchter
Um die besten Züchterinnen und Züchter zu ehren, führte der SHZV den Meisterzüchtertitel ein und liess sich dabei vom kanadischen Modell inspirieren. Dieser Titel belohnt langfristige Zuchterfolge und stützt sich auf die Leistungs- und Exterieurresultate während einer Zeitspanne von 16 Jahren. Die ersten Holstein-Meisterzüchter wurden ernannt.
2011
Linear und Suisselab
Zwei Kapitel gingen für den SHZV zu Ende: Mit der Bildung von Linear AG verzichtete er auf seinen eigenen LBE-Dienst, und die Milchkontrollproben wurden nicht mehr in Grangeneuve sondern bei Suisselab in Zollikofen analysiert.
2013
Europäischer Wettbewerb in Freiburg
Der SHZV und swissherdbook spannten zusammen, um den Europäischen Holstein Wettbewerb in Forum Fribourg zu organisieren. An der Veranstaltung nahmen die besten Kühe aus 12 europäischen Ländern teil. Die Schweiz holte den Grand Champion-Titel mit Decrausaz Iron O’Kalibra.
2015
Lancierung von Holstein Mobile
Das Smartphone war plötzlich auch nicht mehr aus dem Alltag der Züchterinnen und Züchter zu denken. Um ihnen die Arbeit zu erleichtern, lancierte der SHZV Holstein Mobile, die mobile Version von Holstein Vision. Zahlreiche Daten können seither direkt im Stall erfasst werden, und die Züchterinnen und Züchter haben jederzeit Zugriff auf alle Daten.
2017
Der SHZV heisst neu Holstein Switzerland
Um sich als Dienstleister für seine Mitglieder zu profilieren und seine Identität auf internationaler Ebene zu stärken, änderte der SHZV seinen Namen und heisst seither Genossenschaft Holstein Switzerland.
2024
125. Jubiläum
Ein Jubiläum ist kein Alterszeichen sondern ein Beweis für Langlebigkeit! Zu Beginn des Jahres 2024 stellt Holstein Switzerland fest, dass die Holsteinrasse immer noch sehr beliebt ist, nimmt doch die Anzahl registrierter Tiere nicht so stark ab wie der schweizweite Rückgang der Betriebe. Die Genossenschaft nutzt das 125. Jubiläum, um den Mitgliedern Emotionen und gesellige Momente zu bieten, insbesondere an den Holstein Awards am 6. Juli 2024 in Grangeneuve.
Die Entwicklung setzte sich trotzdem fort.
Die elegante Holsteinkuh – einschliesslich Red Holstein – macht zurzeit über 45% des Milchviehbestandes aus. Es gibt 86 Zuchtgenossenschaften und Züchtervereinen in 25 Kantonen. Holstein Switzerland zählt mehr als 1’950 Mitglieder und über 124’000 weibliche Holsteintiere. Die Zukunft steht unter dem Zeichen der Zusammenarbeit mit den anderen Organisationen. Die effiziente und leistungsfähige Holsteinkuh stellt zweifelsohne die Zukunft der Schweizer Milchviehzucht dar.
Holstein Switzerland feiert sein 125 -jähriges Bestehen.

Seit 125 Jahren ist Holstein Switzerland bestrebt, den Bedürfnissen der Holsteinzüchterinnen und -züchter so nahe wie möglich zu sein. Eine Unterstützung und Erleichterung bei der täglichen Arbeit zu sein, bleiben unsere wichtigsten Anliegen. Das Jahr 2024 ist eine gute Gelegenheit, dieses fabelhafte Jubiläum mit Ihnen zu feiern.